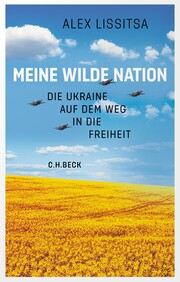Patriotismus
Ein linkes Plädoyer
Erschienen am
15.03.2010
Bibliographische Informationen
ISBN/EAN: 9783579068749
Sprache: Deutsch
Seiten: 207 S.
Format (H/B/T): 2 x 22 x 14.3 cm
Auflage: 1. Auflage 2010
Einband: gebundenes Buch
Beschreibung
Warum man sich zur Gesellschaft bekennen muss Nachdenken über ein neues Engagement für das Allgemeinwohl Engagiert und visionär für eine neue Verständigung über die Prinzipen des Zusammenlebens Jetzt erst recht! Robert Habeck macht sich angesichts der weltweiten Krise für etwas Ungeheuerliches stark: einen 'linken Patriotismus'. Nicht politischer Rückzug ist angesagt, sondern Vertrauen in die Demokratie und Erneuerung eben dieser Demokratie. Sein 'linkes Plädoyer' entwirft neue Strategien, um die alten Widersprüche aufzulösen. Es bricht mit den ideologischen Mustern der Vergangenheit, bringt scheinbar Gegensätzliches zusammen und zentriert die verschiedenen Aspekte in einem Gesamtansatz. Darin werden die ursprünglich bürgerlichen Begriffe Verantwortung, Mündigkeit und Freiheit neu besetzt. Mit seinem 'visionären Pragmatismus' schlägt Habeck einen Weg zur Lösung der Probleme vor, der das soziale und eigenverantwortliche Engagement aller erfordert.
Autorenportrait
Robert Habeck ist Fraktionsvorsitzender der Grünen in Schleswig-Holstein. Er hat sich als einer der ersten für einen neuen Kurs der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit seiner Partei eingesetzt. Als Schriftsteller hat er zusammen mit Andrea Paluch erfolgreiche Romane, Jugendbücher, Theaterstücke geschrieben. Er lebt mit ihr und seinen vier Söhnen an der dänischen Grenze.
Leseprobe
Als ich das erste Mal neben Joschka Fischer stand, passierte etwas Merkwürdiges. Es war auf einem Bundesparteitag in der Messehalle in Hannover, viele Kameras, die Halle flimmerte in grellgrünem Licht, eine nervöse Anspannung war zu spüren, die Grünen steckten mitten in der zweiten Legislatur der rot-grünen Regierung und alle waren sie da, Renate Künast, Jürgen Trittin, Claudia Roth, Daniel Cohn-Bendit. Ich stand im Mittelgang, ein Mann schob sich an mir vorbei mit den Worten, 'Kann ich mal?', kleiner als im Fernsehen, mit krummem Gang. Heute muss ich bei dem Gedanken, dass Joschka Fischer mich fragte, ob er mal könne, lachen und mir fallen diverse Wortspiele ein. In dem Moment aber hatte ich ein merkwürdiges Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit. Es war, als würde ich einen Film sehen, in dem ich gleichzeitig mitspielte, ungefähr so, wie Jim Carry in dem Film 'Die Truman-Show', als er plötzlich erkennt, dass ein Obdachloser sein Vater ist. Und dieses Gefühl habe ich noch heute. 2002 trat ich in die Grünen ein, 2004 wurde ich Landesvorsitzender. Das war im November 2004, kurz vor der Landtagswahl. Direkt nach meiner Wahl wurde eine Kommission gewählt, die die Koalitions-Verhandlungen mit der SPD führen sollte. Und 'die Basis' forderte vehement, dass nicht nur 'Funktionäre' in dieser Kommission saßen. Das ging auch gegen mich. Eben noch war ich Basis und Neumitglied, 20 Minuten später Apparatschik. Dabei hatte ich mich doch gar nicht verändert, hatte mich die Macht noch nicht korrumpiert. Aber so ist es dauernd. Wir wählen Menschen als Hoffnungsträger in Ämter und verlieren, kaum dass sie einen Titel haben, die Hoffnung, dass sie es besser machen. Nicht zwingend, weil die Menschen uns enttäuschen. Auch, weil 'wir' zu schnell bereit sind zu glauben, dass eine Funktion einen Menschen verändert. Visionen zu haben und zu behalten, bedeutet aber, nicht autoritätshörig zu sein. Und das gilt für beide Seiten. Beide Seiten? Welche Seiten denn? Hier das Volk und da die Politiker? Ein Widerspruch. Es gibt wohl keinen Menschen, der in eine Partei eintritt oder sich politisch engagiert, weil er alles gut findet, wie es ist. Sich einbringen, Dinge verändern, es anders machen zu wollen, zeigen, dass es anders geht, deshalb tritt man in eine Partei ein - und schwupps ist man ein Politiker und gehört zu 'denen'. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, als solcher angesprochen zu werden. Politiker? Das sind doch die anderen, die alten Männer mit den dicken Bäuchen, die Schnösel mit den Nadelstreifenanzügen, die man immer verachtet hat. Politik, das ist Uneigentlichkeit und Zynismus. Aber selbst wenn doch Gelderwerb und Ruhmsucht die Antriebsfedern für politisches Engagement sein sollten - die Frage ist gar nicht, ob das stimmt und was ich bin, sondern was diese Haltung bedeutet. Um Politiker zu werden, braucht man keine Ausbildung, noch nicht mal Fachwissen, eher Qualitäten wie Kommunikationsgeschick, Auffassungsgabe, Redetalent - lauter Dinge, die man als 'training on job' nirgendwo als in der Politik erwerben kann. (Und manche, die sich Politiker nennen, haben noch nicht mal das gelernt.) Das erklärt besser als irgendwelche Karrieregeilheit-Vorwürfe, warum so viele Funktionsträger im System Politik aufsteigen und ein Quereinstieg so selten gelingt. Politiker zu sein lernt man am besten und eigentlich nur in der Politik. (Nur wenn man Schriftsteller ist und darin geübt, Romanfiguren nicht nur daraufhin zu überprüfen, was sie tun, sondern auch warum sie es tun, wenn man Shakespeares Dramen kennt, dann bringt man einiges an Rüstzeug bereits mit.) Die Geschlossenheit des politischen Systems ist so offensichtlich, wie es die Grundintention der Demokratie in Frage stellt: Die Lösungen, die die politischen Parteien anbieten, sind Lösungen, die aus den selbstbezüglichen Strukturen des Politiksystems kommen. Das ist erklärlich, aber fatal. Es gebiert eine gewisse Feigheit, neue Ansätze zu wagen, es führt zur Fortsetzung der eingeübten Rituale, es befördert e
Weitere Artikel aus der Kategorie "Sachbücher/Politik, Gesellschaft, Wirtschaft/Politik"
Sofort Lieferbar

Sofort Lieferbar

Noch nicht lieferbar

Noch nicht lieferbar